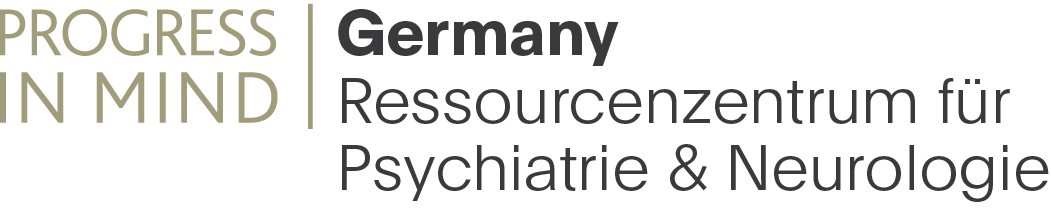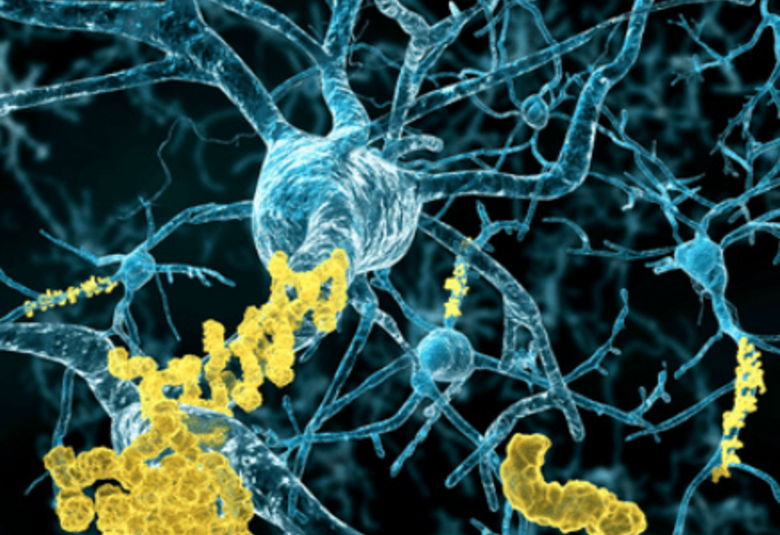Unser Berichterstatter sprach mit Prof. Bernhard Baune, University of Adelaide, Australien, und befragte ihn, wie er Patienten mit affektiven Störungen behandelt sowie zu neuen Erkenntnissen in der Diagnostik und der Therapieforschung sowie bei der Patientenbetreuung.
Einer der anspruchsvollsten Aufgaben bei der Behandlung von Patienten mit affektiven Störungen ist das Assessment vor Therapiebeginn. Oft ist die Beurteilung beim Erstkontakt zu oberflächlich und nicht spezifisch genug. Dies trifft vor allem in der medizinischen Grundversorgung zu, aber auch oft für die Tertiärversorgung. Das Problem ist, bemängelte der Psychiater, dass wir dazu neigen, einen symptomorientierten Ansatz zu wählen, anstatt den Funktionsstatus des Patienten im Alltag genauer zu evaluieren.
Das soll nicht heißen, dass Symptome nicht wichtig sind. Man muss den herabgestimmten Affekt des Patienten verbessern, aber die Behandlung muss auch das Ziel haben, den Funktionsstatus zu verbessern – am Arbeitsplatz oder in der Ausbildung – sowie ihre Lernfähigkeit und Interaktionsfähigkeit der Patienten in ihrem sozialen Umfeld zu verbessern.
Diesen Ansatz setzt Prof. Baune und sein Team bereits bei der Anamneseerhebung und klinischen Untersuchung um. Neben der Bestimmung des Schweregrads der Symptome mithilfe von Standardtools und strukturierten Interviews beurteilen wir auch Funktionsbereiche, die von der kognitiven über den sozialen bis hin zum Funktionsstatus am Arbeitsplatz reichen.
Biomarker und Neuroimaging – Teil der Zukunft
Eines der aktuellsten Themen beim Management der Depression ist derzeit die Identifizierung von Biomarkern, meinte Prof. Baune. Auch auf dem ECNP 2014 gab es hierzu angeregte Diskussionen. Idealerweise sollten unsere Patienten hinsichtlich ihres spezifischen Störungsbildes von Anfang an besser einordnen können. Auch neigen wir gegenwärtig dazu, bei der Therapieplanung eher nach hinten zu schauen. Stattdessen sollten wir, wenn es den künftigen Weg des Patienten angeht, zukunftsorientiert handeln, regte Prof. Baune an.
Es gibt in Europa eine große Initiative zur Identifikation von Neuroimaging-Markern und anderen Biomarkern. Ständen uns zusätzlich zu der umfassenden klinischen Beurteilung auch Blut-basierte Biomarker und Neuroimaging-Marker zur Verfügung, würde uns dies wahrscheinlich helfen bei der Einschätzung des Krankheitsverlaufes, also ob der Patient beispielsweise weitere depressive Episoden erleiden wird. Dadurch würde auch eine individuell ausgerichtete Therapiewahl erleichtert.
Nichts davon ist bislang in der Praxis umgesetzt. Wir erleben jedoch eine Verlagerung weg von einer Forschung, die in ihren Ansichten sehr an den Erkenntnissen querschnittsorientierter Studien orientiert war, hin zu einer stärker vorausschauenden Forschung. Das geschieht international und national und über Forschungsverbünde und -zusammenschlüsse hinweg. Ich erwarte, dass sich dieser Aufwand in einer Reihe von Forschungsfeldern in den nächsten 5-6 Jahren auszahlt und wir dann besser in der Lage sein werden, unseren Patienten besser, weil störungsspezifischer behandeln zu können, hofft der Psychiater.
Ganzheitliches Betreuungskonzept
Was die Behandlung depressiver Patienten angeht, plädiert Prof. Baune für eine Kombination aus medikamentösen und psychotherapeutischen Interventionen. Auch die aktuelle Datenlage weist darauf hin, dass eine Kombination aus Medikamenten und Psychotherapien insgesamt effektiver ist als eine rein medikamentöse Behandlung.
Zu der Reihenfolge, in der medikamentöse und nicht-medikamentöse Interventionen erfolgen sollten oder ob man von Anfang an mit einer Kombinationstherapie beginnen sollte, gibt es unterschiedliche Ansichten. Es kann günstiger sein, so Prof. Baune, mit einer medikamentösen Behandlung zu beginnen, um die Symptome unter Kontrolle zu bekommen und den Patienten darin zu unterstützen, an einen Punkt zu gelangen, an dem er empfänglicher für eine Psychotherapie ist.
Ist es an der Zeit, die „Remission” neu zu definieren?
Natürlich muss man dann auch überdenken, wie eine Remission der Depression definiert werden sollte. Die hierzu benutzten Standardtools und -skalen fokussieren vor allem auf den Affektstatus des Patienten. Die gegenwärtig verwendeten Definitionen von Remission berücksichtigen den Funktionsstatus des Patienten nicht sind daher nicht hilfreich.
Prof. Baune schätzt daher den Begriff „Remission“ in der jetzigen Form nicht. Die Definition des Behandlungserfolgs muss vielmehr auch vor dem Hintergrund der Verbesserung des Funktionsstatus betrachtet werden.
Die Assoziation zwischen Verbesserungen des Affektstatus und Verbesserungen der Kognition ist nur schwach. Etwa ein Drittel der depressiven Patienten erfährt eine Stimmungsaufhellung ohne Änderung ihres kognitiven Funktionsstatus.
Wir müssen anhand des spezifischen Störungsbildes mit dem Patienten zusammen diskutieren, was er sich von der Behandlung erwartet, so der Psychiater. Danach können wir eine Behandlungsstrategie entwickeln, die pharmakologische und nicht-pharmakologische Interventionen einschließt. Er würde bei einer antidepressiven Pharmakotherapie bei Patienten mit kognitiven Beeinträchtigungen keine Wirkstoffe einsetzen, die speziell nur zur Behandlung kognitiver Symptome indiziert sind. Das gilt auch für Wirkstoffe, die für andere Indikationen zugelassen sind, zum Beispiel der ADHS, und von denen man sich eine Beeinflussung kognitiver Beeinträchtigungen der Depression erhofft. Prof. Baune plädierte für die Gabe von Antidepressiva auf der Grundlage einer nachgewiesenen Wirksamkeit bei affektiven und kognitiven Beeinträchtigungen. Des Weiteren würde er einen Therapieplan nicht-medikamentöser Interventionen zur Verbesserung der kognitiven Funktion zusammenstellen, dass auch die physische Aktivität und Änderungen der Lebensweise beinhaltet.
Les points saillants du colloque présentés par notre correspondant se veulent une représentation fidèle du contenu scientifique présenté. Les points de vue et opinions exprimés sur cette page ne reflètent pas nécessairement ceux de Lundbeck.